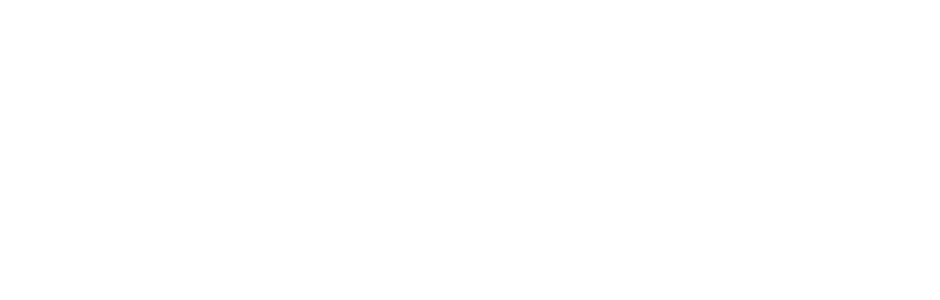Es geht zulasten des Steuerpflichtigen, der die Anwendung der Differenzbesteuerung begehrt, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen des § 25a UStG unerwiesen geblieben ist und er nicht alle ihm zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um Unregelmäßigkeiten in Bezug auf seinen jeweiligen Geschäftspartner nachzugehen.
Sachverhalt
Der Steuerpflichtige handelt mit gebrauchten Kfz. Für den Besteuerungszeitraum 2014 (Streitjahr) meldete der Steuerpflichtige keine regelbesteuerten Kfz-Lieferungen an, sondern nur Umsätze unter Anwendung der Differenzbesteuerung.
In 2016 führte das Finanzamt bei dem Steuerpflichtigen eine Außenprüfung durch, die die Umsatzsteuer für das Streitjahr und den Besteuerungszeitraum 2015 umfasste.
Nach den Feststellungen der Prüferin kaufte der Steuerpflichtige in 29 Fällen unter Verwendung üblicher Musterverträge Kfz von angeblichen „Privatverkäufern“, wobei der jeweilige Verkäufer nicht mit dem letzten eingetragenen Halter des Kfz identisch war. Nach Auffassung der Prüferin habe der Steuerpflichtige dies beim Ankauf erkennen und daraus den Schluss ziehen müssen, dass der jeweilige Verkäufer als Händler tätig ist, sofern dieser ihm keine Verkaufsvollmacht des letzten Halters hat vorlegen können. Die Prüferin stellte Mehrumsätze fest, auf die die Regelbesteuerung anzuwenden sei.
Ferner hat der Steuerpflichtige zu diversen weiteren aufgrund von Musterverträgen gelieferten Kfz Fahrgestellnummern angegeben, die vom Kraftfahrt-Bundesamt nicht haben ermittelt werden können. Nach Auffassung der Prüferin sei vom Unternehmer zu verlangen, dass er in seinen Buchführungsunterlagen und Rechnungen richtige und überprüfbare Daten angibt, zumal die Anwendung der Differenzbesteuerung von den Ankaufsmodalitäten abhänge. Der Steuerpflichtige habe die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nur eingeschränkt beachtet, was nicht gänzlich zulasten der Finanzverwaltung gehen könne. Da er aber eher versehentlich unzutreffende Angaben gemacht habe, sei die Differenzbesteuerung nur für 20 % der betroffenen Umsätze zu versagen mit der Folge, dass die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer zu erhöhen sei.
Auf der Grundlage des Prüfungsberichts erließ das Finanzamt einen entsprechenden Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für das Streitjahr. Der Einspruch des Steuerpflichtigen hatte nur hinsichtlich weiterer, hier nicht streitiger Prüfungsfeststellungen Erfolg. Im Übrigen wies das Finanzamt den Einspruch als unbegründet zurück.
Auch eine Klage vor dem FG blieb erfolglos. Hiergegen wendet sich der Steuerpflichtige mit der Revision.
Entscheidung
Die Revision ist unbegründet. Im Streitfall ist das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 25a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 UStG unerwiesen geblieben, nämlich, ob für die vom Steuerpflichtigen empfangene jeweilige Lieferung eines Kfz
-
Umsatzsteuer nicht geschuldet (Buchst. a Alt. 1) oder
-
nach § 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben (Buchst. a Alt. 2) oder
-
die Differenzbesteuerung vorgenommen (Buchst. b) wurde.
Da zu sämtlichen streitbefangenen Lieferungen des Steuerpflichtigen als Wiederverkäufer jeweils ein „Privatvertrag“ über den vorangegangenen Ankauf des betreffenden Kfz vorliegt, würde – soweit es sich tatsächlich um einen Privatverkäufer bzw. Nichtsteuerpflichtigen handelte – die Umsatzsteuer für die vorangegangene Lieferung nicht geschuldet. Allerdings hat das FG angenommen, dass allein aus dem Vorliegen von Musterkaufverträgen, die typischerweise bei privaten Kfz-Verkäufen genutzt werden, nicht mit der erforderlichen Gewissheit gefolgert werden könne, dass die Verkäufer tatsächlich Privatpersonen waren, zumal in keinem dieser Fälle der jeweilige Verkäufer mit dem letzten Halter des Kfz identisch war. Soweit der Steuerpflichtige unzutreffende bzw. unvollständige Fahrgestellnummern aufgezeichnet hatte, konnten keine weiteren Einzelheiten zu den letzten Haltern und Verkäufern ermittelt werden. Es sei eine durchaus naheliegende Möglichkeit, dass ein Zwischenverkauf des Kfz von einer Privatperson an einen Händler stattgefunden hat. Diese tatsächliche Würdigung des FG ist aufgrund der festgestellten Tatsachen möglich und verstößt nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze. Sie bindet daher den BFH.
Es geht zulasten des Steuerpflichtigen, der die Anwendung der Differenzbesteuerung begehrt, dass das Vorliegen der betreffenden Tatbestandsmerkmale unerwiesen geblieben ist und er nicht alle ihm zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die jeweils als „Privatverkäufer“ aufgetretene Person nachzugehen.
Dem Steuerpflichtigen steht daher kein Vertrauensschutz zu. Im Streitfall handelte es sich bei den Erwerben um einmalige Geschäftsbeziehungen mit für den Steuerpflichtigen unbekannten Personen. Außerdem war der letzte Halter des angekauften Kfz nicht mit der Person des Verkäufers identisch. Der Steuerpflichtige hat daher nicht ohne Weiteres auf die Behauptung des jeweiligen Verkäufers vertrauen können, als Privatverkäufer zu handeln.
In diesem Fall hätte sich ein verständiger Wirtschaftsteilnehmer zumindest die Verkaufsvollmacht vorlegen lassen müssen. Wird eine solche nicht vorgelegt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem betreffenden Verkäufer um einen „verkappten“ Händler handelt, der seine Händlereigenschaft zum Zwecke einer Steuerhinterziehung verschleiert.
Ein etwaiges Vertrauen des Steuerpflichtigen darauf, der jeweilige Verkäufer des Kfz sei Kleinunternehmer, weshalb die Steuer nach § 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben worden sei, oder Unternehmer, der seinerseits die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG vorgenommen habe, fände in den hier ausschließlich eingegangenen Verträgen über Privatverkäufe keine Grundlage.
Praxistipp
Die Tatsache, dass der Steuerpflichtige die Aufzeichnungspflichten für die Differenzbesteuerung erfüllt hat, vermag das Verwirklichen des Tatbestands der Differenzbesteuerung bzw. das Vorliegen eines diesbezüglichen schützenswerten Vertrauens nicht zu ersetzen.
fundstelle