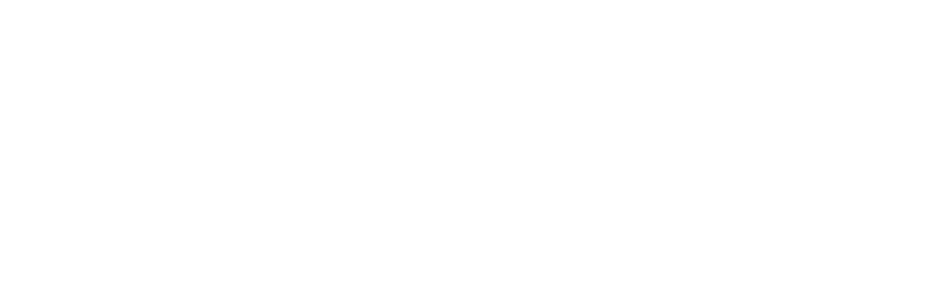Gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO beginnt die Festsetzungsfrist, wenn eine Steuererklärung oder eine Steueranmeldung einzureichen oder eine Anzeige zu erstatten ist, mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuererklärung, die Steueranmeldung oder die Anzeige eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist, es sei denn, dass die Festsetzungsfrist nach § 170 Abs. 1 AO später beginnt. Entscheidend war im Streitfall: Wann beginnt die Festsetzungsfrist, wenn nicht der eigentliche Steuerschuldner, sondern der Geschäftsführer als Haftungsschuldner herangezogen wird, weil er kraft Gesetzes die Steuererklärungen oder -anmeldungen für die vertretene GmbH abzugeben hat? Und: Darf die Finanzverwaltung nach Rücknahme eines ersten Haftungsbescheids später erneut den Geschäftsführer – auf anderer Rechtsgrundlage – zur Haftung heranziehen? Diese Fragen standen im Fokus der Entscheidung des BFH.
Sachverhalt
Der Kläger war 2006 bis 2011 Geschäftsführer der X-GmbH. Steuererklärungen wurden nicht abgegeben. Erst im Rahmen einer Betriebsprüfung wurden Erklärungen nachgereicht, anschließend ergingen Steuerbescheide gegen die GmbH. Einen Haftungsbescheid nach § 69 AO aus April 2016 nahm das Finanzamt 2017 zurück.
Nach einem strafrechtlichen Schuldspruch wegen vorsätzlicher verspäteter Abgabe von Umsatzsteuererklärungen (2007 bis 2012) erließ das Finanzamt im Mai 2018 erneut einen Haftungsbescheid – nun unter Bezugnahme auf § 71 AO – u. a. für die Umsatzsteuer 2006. Das FG Düsseldorf hob die Haftung insoweit wegen Verjährung auf. Der BFH gab der Revision des Finanzamts statt.
Entscheidung
Der BFH stellt voran, dass die in § 191 Abs. 3 Satz 1 AO enthaltene Analogieverweisung dazu führt, § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO „entsprechend“ auch im Haftungsverfahren anzuwenden, wenn der Haftungsschuldner – etwa als Geschäftsführer – gesetzlich verpflichtet ist, für den Vertretenen Steuererklärungen oder -anmeldungen einzureichen. Inhaltlich wird die Bezugsnorm damit gedanklich so umformuliert, dass die Anlaufhemmung auch denjenigen erfasst, der die Erklärungs- bzw. Anmeldepflicht für den Vertretenen trägt. Damit wird eine sachwidrige Privilegierung des Haftungsschuldners gegenüber Steuer- oder Entrichtungsschuldnern vermieden. Der BFH knüpft damit zugleich an die bisherige Rechtsprechung zur Anlaufhemmung bei Entrichtungssteuern an.
Für den Streitfall bedeutet dies: Hinsichtlich der Umsatzsteuer 2006 begann die Festsetzungsfrist aufgrund der „spätestens“-Regel des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO mit Ablauf des dritten auf das Entstehungsjahr folgenden Kalenderjahrs, also mit Ablauf des Jahres 2009. Wegen der Haftung nach § 71 AO (Steuerhinterziehung) beträgt die Frist zehn Jahre (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO i. V. m. § 191 Abs. 3 Satz 2 AO), sie endete damit am 31.12.2019. Der am 7.5.2018 erlassene Haftungsbescheid lag innerhalb der Frist. Soweit die Vorinstanz eine Anlaufhemmung im Haftungsverfahren verneint hatte, weist der BFH diese Auffassung ausdrücklich zurück.
Auch verfahrensrechtlich stand dem Neuerlass des Haftungsbescheids nichts entgegen. Die vorangegangene Rücknahme des Bescheids aus 2016 begründete keinen Vertrauensschutz, weil der neue Haftungsbescheid nicht „denselben Sachverhalt“ betraf: Er stützte sich auf eine andere Haftungsnorm (§ 71 AO statt § 69 AO). Einschränkungen nach § 130 Abs. 2 AO bzw. aus Treu und Glauben greifen insoweit nicht. Schließlich ist bei beschränkt zugelassener Revision eine Anschlussrevision zu anderen Urteilsteilen unzulässig.
Relevanz für die Praxis
Die Entscheidung klärt eine praxisrelevante Unsicherheit und bringt die Haftungssystematik in Einklang mit den Grundsätzen zur Anlaufhemmung beim Steuerschuldner. Für die Beratungspraxis bedeutet das u. a.: Wenn ein Geschäftsführer als gesetzlicher Vertreter zur Abgabe von Erklärungen oder Anmeldungen verpflichtet ist, hemmt § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO den Beginn der Festsetzungsfrist für den Haftungsbescheid in entsprechender Anwendung. Die zeitliche „Kappung“ („spätestens mit Ablauf des dritten Folgejahres“) ist in der Zeitleiste zwingend zu berücksichtigen. Bei Anwendung von § 71 AO (Haftung bei Steuerhinterziehung) ist sodann die zehnjährige Frist zu berechnen.
Zudem eröffnet das Urteil Handlungsspielräume der Verwaltung beim Neuerlass: Wurde ein Haftungsbescheid zurückgenommen, kann ein erneuter Bescheid zulässig sein, sofern er auf anderer Haftungsgrundlage und damit einem anderen haftungsbegründenden Sachverhalt beruht. In der Abwehrberatung empfiehlt es sich daher, genau zu prüfen, ob wirklich ein anderer Sachverhalt zugrunde liegt oder ob – trotz neuer Norm – materiellrechtlich im Haftungsbescheid im Kern derselbe Lebenssachverhalt angesprochen wird.
Schließlich ist bei Revisionen eine etwaige beschränkte Zulassung zu beachten. Eine Anschlussrevision über den zugelassenen Teil hinaus ist unzulässig.
fundstelle