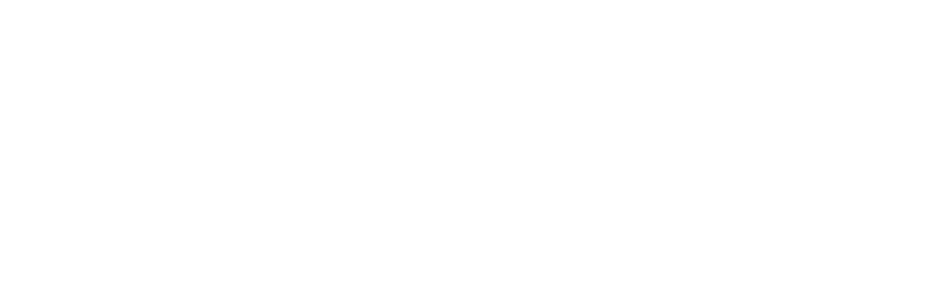Der Umstand, dass eine KG gewerblich geprägt ist, steht der Teilwertabschreibung einer wertlosen Darlehensforderung des Gesellschafters gegen die KG vor deren Vollbeendigung nicht entgegen, wenn wegen einer Betriebsaufgabe der KG die Grundsätze korrespondierender Bilanzierung nicht mehr eingreifen.
Sachverhalt
Die Steuerpflichtige, eine GmbH & Co. KG, hielt als alleinige Kommanditistin 100 % der Anteile an der im Jahr 2011 gegründeten L-GmbH & Co KG. Streitig war, ob die L-KG zum 31.8.2012 ihren Betrieb aufgegeben hat und ob in diesem Fall eine Teilwertabschreibung auf eine im Sonderbetriebsvermögen gehaltene Darlehensforderung der Steuerpflichtigen gegenüber der L-KG vorzunehmen wäre.
Entscheidung
Der BFH kam – wie zuvor bereits das FG – zu dem Ergebnis, dass zum 31.8.2012 der Betrieb der L-KG aufgegeben worden war. Er hob jedoch das Urteil des FG auf, da es rechtsfehlerhaft zu dem Ergebnis gelangt war, dass der Steuerpflichtigen in den Streitjahren kein Verlust aus einer Teilwertabschreibung der bis zur Betriebsaufgabe der L-KG im Sonderbetriebsvermögen der Steuerpflichtigen gehaltenen Darlehensforderung gegenüber der L-KG entstanden sei.
Die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung von Darlehensforderungen des Gesellschafters gegen die Personengesellschaft in der Sonderbilanz und der Gesamthandsbilanz stehen bei einer Betriebsaufgabe einer Teilwertabschreibung für eine wertlose Darlehensforderung nicht entgegen. Dies gilt auch bei gewerblich geprägten Personengesellschaften i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG.
Ansprüche eines Gesellschafters aus einer gegenüber der Personengesellschaft bestehenden Darlehensforderung gehören zwar nicht zu dem in der Gesellschaftsbilanz (Gesamthandsbilanz) auszuweisenden Eigenkapital, wohl aber zum Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters, das in der aus Gesellschaftsbilanz und Sonderbilanzen zu bildenden Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft als Eigenkapital behandelt wird. Auch wenn feststeht, dass eine solche Darlehensforderung wertlos ist, weil sie von der Gesellschaft nicht beglichen werden kann, folgt aus der Behandlung als Eigenkapital, dass eine Wertberichtigung während des Bestehens der Gesellschaft regelmäßig nicht in Betracht kommt. Das Imparitätsprinzip gilt insoweit nicht. Vielmehr wird dieser Verlust im Sonderbetriebsvermögen ebenso wie der Verlust der Einlage in das Gesellschaftsvermögen grundsätzlich erst im Zeitpunkt der Beendigung der Mitunternehmerstellung, also beim Ausscheiden des Gesellschafters oder bei Beendigung der Gesellschaft realisiert.
Aus der Gleichbehandlung eines Verlusts im Sonderbetriebsvermögen mit dem Verlust einer Einlage in das Gesellschaftsvermögen folgt, dass maßgeblich für die Verlustrealisierung infolge der Wertlosigkeit einer Darlehensforderung der Zeitpunkt ist, zu dem die Gesellschaft ihren Gewerbebetrieb im Ganzen aufgibt oder veräußert. Die auf diesen Zeitpunkt aufzustellende Schlussbilanz zur Ermittlung des Gewinns oder Verlusts aus der Betriebsveräußerung oder -aufgabe tritt an die Stelle der handelsrechtlichen Liquidationsschlussbilanz. Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn schließt grundsätzlich das Ergebnis der gewerblichen Betätigung des Gesellschafters ab. Deshalb sind bei der Ermittlung des Aufgabegewinns oder -verlusts sämtliche Aufwendungen des Gesellschafters gewinnmindernd zu berücksichtigen, die mit dem Aufgabevorgang verbunden sind.
Dabei steht der Verlustrealisierung bei Wertlosigkeit einer Darlehensforderung im Sonderbetriebsvermögen im Zeitpunkt der Betriebsaufgabe der Gesellschaft deren Organisationsform als eine gewerblich geprägte Personengesellschaft i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG nicht entgegen.
Hierfür sprechen bereits der Sinn und Zweck des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Danach gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ausübt und bei der ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte Personengesellschaft). Zweck dieser gesetzlichen Fiktion einer gewerblichen Tätigkeit ist, die auf den Betrieb durch die Komplementär-GmbH angelegte Personengesellschaft gewerbesteuerlich ebenso zu behandeln wie eine Kapitalgesellschaft und eine zweifache Gewinnermittlung zu vermeiden. Sie dient jedoch nicht dazu, eine durch Betriebsaufgabe beendete mitunternehmerische Tätigkeit als fortbestehend zu fingieren. Allein die bloße Hülle einer gewerblich geprägten Personengesellschaft begründet beziehungsweise fingiert keine mitunternehmerisch ausgeübte gewerbliche Tätigkeit ihrer Gesellschafter.
Zu beachten ist, dass es im Fall einer vorherigen Beendigung der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft auf den Zeitpunkt der Vollbeendigung einer Gesellschaft nicht ankommt. Zu einer Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 EStG kommt es daher z. B. auch dann, wenn eine der tatbestandlichen Voraussetzungen für eine gewerblich geprägte Personengesellschaft nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG entfällt.
Der BFH wies den Streitfall an das FG zurück, weil er die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welchem Streitjahr die als Sonderbetriebsverluste geltend gemachten Aufwendungen danach zu berücksichtigen sind, aufgrund der bisherigen Feststellungen des FG nicht entscheiden konnte.
fundstelle