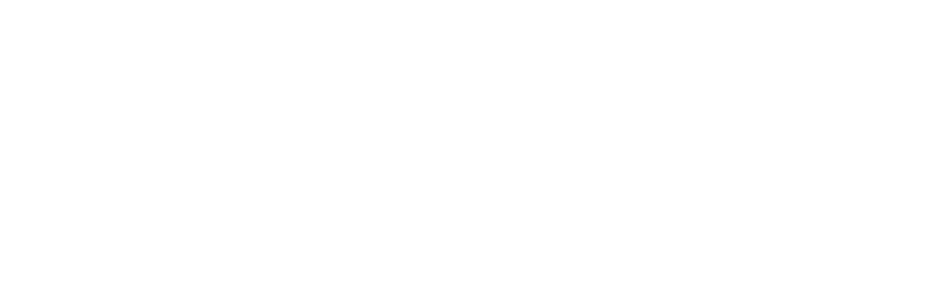Der BGH und der BFH haben aktuell wichtige praxisrelevante Fragen geklärt, die sich in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) bei der Änderung von Kostenverteilungsschlüsseln und der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zahlungen in die WEG-Erhaltungsrücklage stellen.
Änderung vereinbarter Kostenverteilung durch Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümer
Der BGH hat aktuell auf Basis der WEG-Reform von 2020 in zwei Entscheidungen weitere Vorgaben zu den Voraussetzungen gemacht, unter denen die Wohnungseigentümer eine von einer Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung abweichende Kostentragung beschließen können (BGH 14.2.25, V ZR 236/23, V ZR 128/23).
Sachverhalt im Streitfall
Im ersten Streitfall (BGH V ZR 236/23) war die Klägerin Mitglied der beklagten Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Zur WEG-Anlage gehörte eine Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. Die Gemeinschaftsordnung von 1971 ordnete die Nutzung der Stellplätze ausschließlich bestimmten Wohneinheiten zu. Außerdem regelte die Gemeinschaftsordnung, dass die Kosten für die Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums in und an der Garagenhalle ausschließlich von diesen Wohneinheiten zu tragen waren. Die Wohneinheit der Klägerin verfügte nicht über ein Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz. Im April 2022 beschlossen die Wohnungseigentümer, das Dach der Garagenhalle sanieren zu lassen und die damit verbundenen Kosten auf sämtliche Wohnungseigentümer im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile umzulegen. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit einer Anfechtungsklage, die vor dem AG und in der Berufungsinstanz vor dem LG Erfolg hatte.
Beachten Sie | In einem zweiten BGH-Verfahren (14.2.24, V ZR 128/23) wurde von einer WEG im Jahr 2021 beschlossen, die bislang nach Miteigentumsanteilen umgelegten Kosten zukünftig nach der beheizbaren Wohnfläche zu verteilen und diesen Schlüssel auch für die Zuführung zu der Erhaltungsrücklage anzuwenden.
Entscheidung des BGH
Die beklagte WEG war mit der vom LG zugelassenen Revision vor dem BGH (V ZR 236/23) erfolgreich, der die Vorentscheidung aufgehoben und zur erneuten Prüfung zurückverwiesen hat, weil das LG die Beschlusskompetenz der WEG verneint hatte. Nunmehr wird das LG klären müssen, ob die Beschlüsse ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen. Zu prüfen ist dies vom LG nur dann, wenn innerhalb der einmonatigen Anfechtungsfrist (§ 45 WEG) Klage gegen die Beschlüsse erhoben worden ist.
Praxistipp
Diese Frist (§ 45 WEG) beginnt mit dem Tag der Versammlung, in der der Beschluss gefasst wurde, unabhängig davon, wann das Protokoll der Versammlung ausgehändigt wird.
Beschlusskompetenz der WEG
Nach der Gemeinschaftsordnung waren im zweiten Streitfall (BGH V ZR 236/23) die bei der Sanierung des Tiefgaragendaches entstehenden Kosten nur von den Einheiten mit Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz zu tragen. Die nach 2020 neu beschlossene Verteilung der Kosten nach Miteigentumsanteilen führt dazu, dass auch Wohnungseigentümer ohne Stellplatz – wie die Klägerin – für die Sanierung des Tiefgaragendachs zahlen müssen. Damit stellte sich die Frage, ob die WEG eine solche Entscheidung überhaupt treffen durfte, also die Beschlusskompetenz hatte.
Beachten Sie | Inwieweit es bei einer vereinbarten objektbezogenen Kostentrennung ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen kann, durch Beschluss auch die zuvor kostenbefreiten Wohnungseigentümer an den auf einen der Gebäudeteile entfallenden Erhaltungskosten zu beteiligen, war unter der Geltung der alten Rechtslage ungeklärt. Nach dem bis zum 30.11.2020 geltenden WEG-Recht waren derartige Beschlüsse schon mangels Beschlusskompetenz ohne Weiteres nichtig.
Der WEG-Beschluss von 2022 sollte im Streitfall die in der Gemeinschaftsordnung vereinbarte objektbezogene Kostentrennung zwischen Gebäude und Tiefgarage gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG konstitutiv ändern. Die erforderliche Beschlusskompetenz besteht nach Ansicht des BGH auch dann, wenn der Kreis der Kostenschuldner verändert wird, indem Wohnungseigentümer erstmals mit Kosten belastet werden (so auch BGH 22.3.24, V ZR 81/23). Das ist eine Folge der neuen, seit 1.12.2020 geänderten WEG-Rechtslage.
Merke | Das WEG wurde durch Modernisierungsgesetz vom 22.10.2020 (BGBl I 20, 2187) mit weitreichenden Änderungen für Verwalter und Eigentümergemeinschaft geändert. Die aufgrund des WEG-Modernisierungsgesetzes (BGBl I 20, 2187) zum 1.12.2020 erfolgte Veränderung der Verwaltungsstruktur der Wohnungseigentümergemeinschaft hat dazu geführt, dass Ansprüche der Wohnungseigentümer, die nach altem Recht gegen den Verwalter oder die übrigen Wohnungseigentümer bestanden, nunmehr gegen den Verband zu richten sind (BGH 7.5.21, V ZR 299/19, NJW-RR 2021, 1170 Rn. 19). Für die Durchführung von Beschlüssen der Wohnungseigentümer war bislang der Verwalter zuständig. Da aber nach dem neuen Recht die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums sowohl im Außenverhältnis als auch im Innenverhältnis ausschließlich der WEG obliegt (§ 18 Abs. 1 WEG), ist nunmehr diese für die Umsetzung der Beschlüsse passivlegitimiert (BGH 16.12.22, V ZR 263/21, NJW-RR 2023, 226 Rn. 26).
Der Bundesrat hat am 27.9.2024 mit der abermaligen Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gebilligt, dass im Wohnungseigentumsrecht auch virtuelle Eigentümerversammlungen stattfinden können (BGBl I 24, Nr. 306, 16.10.24). Nach § 23 Abs. 1a WEG n. F. können die Wohnungseigentümer mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschließen, dass die Versammlung innerhalb eines Zeitraums von längstens drei Jahren ab Beschlussfassung ohne physische Präsenz der Wohnungseigentümer und des Verwalters an einem Versammlungsort stattfindet oder stattfinden kann (virtuelle Wohnungseigentümerversammlung).
Beschließen die Wohnungseigentümer für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer eine Änderung der bisherigen Verteilung, dürfen sie nach der BFH-Rechtsprechung jeden Maßstab wählen, der den Interessen der Gemeinschaft und der einzelnen Wohnungseigentümer angemessen ist und insbesondere nicht zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung Einzelner führt.
Beachten Sie | Nach Ansicht des BFH (V ZR 128/23) begründet – anders als unter der früheren Rechtslage – nunmehr § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG (auch) eine Kompetenz zur Änderung des Verteilungsschlüssels für die Zuführung zu Rücklagen. Grund für die fehlende Beschlusskompetenz nach dem alten Recht war, dass § 16 Abs. 4 WEG a. F. eine Änderung der Kostenverteilung nur für den Einzelfall ermöglichte, während Rücklagen für den zukünftigen, noch nicht konkret vorhersehbaren Bedarf bestimmter Maßnahmen gebildet werden. Eine solche Beschränkung enthält § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG jetzt nicht mehr. Nach Ansicht des BGH hebt die Formulierung „bestimmte Arten von Kosten“ in § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG lediglich das allgemein für Beschlüsse geltende Bestimmtheitserfordernis hervor, begründet aber keine darüber hinausgehenden Anforderungen.
Voraussetzungen einer Änderung der Kostenverteilung nach neuem WEG
Vereinbarte objektbezogene Kostentrennung entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung
Der BGH hat zur neuen, seit 2020 geltenden WEG-Rechtslage jetzt entschieden, dass es bei einer vereinbarten objektbezogenen Kostentrennung i. d. R. ordnungsmäßiger Verwaltung widerspricht, durch Beschluss auch die übrigen Wohnungseigentümer an den auf diesen Gebäudeteil (hier der Tiefgarage) entfallenden Kosten zu beteiligen.
Nach typisierender Betrachtungsweise ist laut BGH nämlich davon auszugehen, dass eine vereinbarte Kostentrennung für die konkrete Anlage grundsätzlich angemessen ist. Regelmäßig wird die objektbezogene Kostentrennung deshalb vereinbart, weil sich Gebrauch bzw. Gebrauchsmöglichkeiten besonders stark unterscheiden, wie es insbesondere in WEG-Anlagen mit unterschiedlich genutzten Gebäudeteilen oder in WEG-Mehrhausanlagen der Fall ist. Deshalb bedarf es in einer solchen Fallkonstellation – anders als bei üblichen Beschlüssen über die Änderung der Kostenverteilung – eines sachlichen Grundes, damit die Kosten abweichend auf alle Wohnungseigentümer verteilt werden dürfen.
Erfordernis eines „sachlichen Grundes“ bei abweichender Kostenverteilung
Wann ein „sachlicher Grund“ für die Einbeziehung der übrigen Wohnungseigentümer gegeben ist, lässt sich nicht abstrakt beantworten, sondern hängt von der jeweiligen konkreten Fallgestaltung ab.
In dem vom BGH entschiedenen Fall könnte es laut BGH jedenfalls ausreichend sein, wenn die Kosten der Beseitigung von Schäden dienen, die von dem übrigen Gemeinschaftseigentum außerhalb der Tiefgarage herrühren. Ebenso kann ein sachlicher Grund gegeben sein, wenn sich das Problem, für dessen Beseitigung die Kosten verursacht werden, auf die gesamte Anlage erstreckt, und aus diesem Grund eine Gesamtsanierung der Anlage unter Beteiligung aller Wohnungseigentümer beschlossen wird.
Praxistipp
Es stellt allerdings bei einer vereinbarten objektbezogenen Kostentrennung zwischen Tiefgarage und Gebäude für sich genommen noch keinen „sachlichen Grund“ für eine Beteiligung aller Miteigentümer dar, dass die Kosten Teile des Gemeinschaftseigentums betreffen, die auch für das übrige Gemeinschaftseigentum, insbesondere aus Gründen der Statik, von Bedeutung sind.
Abzugsfähigkeit von Zahlungen des Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage
Leistungen eines Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind steuerlich nicht schon im Zeitpunkt der Einzahlung, sondern erst dann als Werbungskosten abziehbar, wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen entnommen werden. Dies hat der BFH (14.1.25, IX R 19/24) ganz aktuell entschieden.
Sachverhalt im Streitfall
Die Kläger vermieteten mehrere Eigentumswohnungen. Das von ihnen an die jeweilige Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gezahlte Hausgeld wurde zum Teil der gesetzlich vorgesehenen Erhaltungsrücklage (vormals Instandhaltungsrückstellung) zugeführt. Insoweit erkannte das Finanzamt keine Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften an. Es meinte, der Abzug könne erst in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückgelegten Mittel für die tatsächlich angefallenen Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum verbraucht würden. Das Finanzgericht wies die Klage ab.
Entscheidung des BFH
Die Revision der Kläger beim BFH (IX R 19/24) blieb erfolglos. Der Werbungskostenabzug nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG fordert einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der Vermietungstätigkeit und den Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Die Kläger hatten den der Erhaltungsrücklage zugeführten Teil des Hausgeldes zwar erbracht und konnten hierauf nicht mehr zurückgreifen, da das Geld ausschließlich der WEG gehört. Auslösender Moment für die Zahlung war aber nicht die Vermietung, sondern die rechtliche Pflicht jedes Wohnungseigentümers nach Maßgabe der Gemeinschaftsordnung, am Aufbau und an der Aufrechterhaltung einer angemessenen Rücklage für die Erhaltung des Gemeinschaftseigentums mitzuwirken. Ein Zusammenhang zur Vermietung und der Einkunftserzielung (§ 21 EStG) entsteht erst, wenn die Gemeinschaft die angesammelten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen tatsächlich verausgabt. Denn erst dann kommen die Mittel der Immobilie tatsächlich zugute. Der BFH hat auch bekräftigt, dass auch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes im Jahr 2020 (WEG-Modernisierungsgesetz v. 16.10.20, BGBl I 20, 2187, in Kraft seit 1.12.20), durch die der Wohnungseigentümergemeinschaft die volle Rechtsfähigkeit (§ 9a Abs. 1 S. 1 WEG) zuerkannt wurde, die steuerrechtliche Beurteilung des Zeitpunkts des Werbungskostenabzugs für Zahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht verändert.
Einordnung und praktische Konsequenzen
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) kommt es für den Werbungskostenabzug (§ 9 Abs. 1 S. 2 EStG) einerseits auf den mit den Aufwendungen verfolgten Zweck, der auf die Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung gerichtet sein muss, und andererseits auf die Verwendung der Mittel an. Nach der aktuellen BFH-Entscheidung entsteht ein Zusammenhang zur Vermietung erst, wenn die Gemeinschaft die angesammelten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt, sie also der Immobilie zugutekommen. Dies entspricht ständiger BFH-Rechtsprechung, die der BFH jetzt ausdrücklich bekräftigt. Er erläutert dabei, dass Hausgeldzahlungen (oder Sonderzahlungen) in die Erhaltungsrücklage zunächst nur der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, jedoch noch nicht unmittelbar der Einnahmenerzielung dienen.
Zivilrechtlich steht das der Rücklage zugeführte Vermögen nur der WEG in ihrer Gesamtheit zu. Der einzelne Wohnungseigentümer hat hieran keinen rechtlich anzuerkennenden, frei veräußerbaren Anteil. Der einzelne Eigentümer ist aber als Mitglied der WEG – zumindest wirtschaftlich betrachtet – am Bestand der Rücklage beteiligt. Deshalb hat er gegen die WEG einen klagbaren Anspruch auf Bezahlung künftiger Erhaltungsaufwendungen aus den Mitteln der Rücklage.
Veräußert der in die Erhaltungsrücklage einzahlende Wohnungseigentümer sein Eigentum vor Durchführung der Erhaltungsmaßnahme, bleibt ihm zwar endgültig ein Werbungskostenabzug verwehrt. Er wird in aller Regel aber einen Ausgleich vom Erwerber (Käufer) für den diesem wirtschaftlich zugutekommenden Rücklagenbestand durch einen Kaufpreisaufschlag erhalten (BFH 9.12.08, IX B 124/08, BFH/NV 2009, 571). Eine gut dotierte Erhaltungsrücklage ist nämlich ein wertbildender Faktor, von dem der Eigentümer beim Verkauf der Immobilie profitiert. Allerdings ist zu bedenken, dass (hohe) Zuzahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern auch zu einer Kapitalbindung ohne hohe Rendite führen, weil der Verwalter dieses Kapital i. d. R. mündelsicher und kapitalerhaltend anlegen muss. Wohnungseigentümer sollten deshalb darauf achten, dass Zahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht „ins Blaue hinein“ erfolgen, sondern erst bei zeitnaher Verwendung.
fundstellen
-
BGH 14.2.25, V ZR 128/23, V ZR 236/23,
-
WEG-ÄnderungsG BGBl. 2020 I S. 2187
-
Gesetz zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen, zur Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für Erneuerbare-Energien-Anlagen, BT-Drs. 20/9890 (BGBl. 2024 I Nr. 306, 16.10.24,
-
BFH 25.2.25, PM 10/2025,
-
BFH 14.1.25, IX R 19/24, Abruf-Nr. 246819
-
BFH 9.12.08, IX B 124/08, Abruf-Nr. 090692, BFH/NV 2009, 571