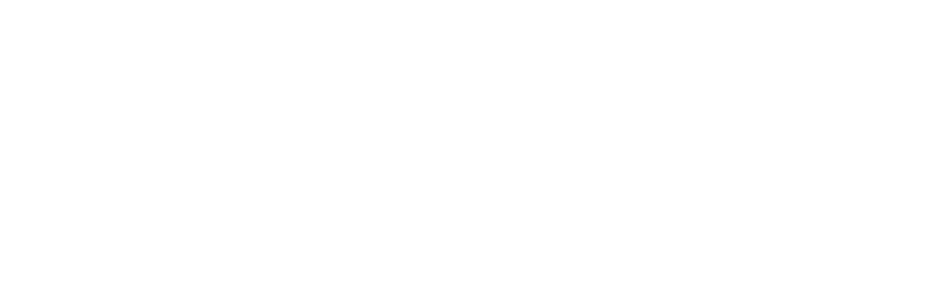Maßgebend für eine Aktivierung ist nicht, ob eine Forderung oder ein Anspruch fällig oder ein Recht realisierbar ist, sondern ob der Vermögensvorteil wirtschaftlich ausnutzbar ist und damit einen realisierbaren Vermögenswert darstellt.
Sachverhalt
Im Streitfall ging es um Forderungen aus einem Beratervertrag. Die Steuerpflichtige hatte die unterjährig jeweils monatlich entstandenen Ansprüche aus dem abgeschlossenen Beratervertrag zunächst zutreffend jeweils als Forderung im Rahmen ihrer laufenden Buchführung gewinnwirksam erfasst. Die Forderungen waren nach dem Vorsichts- und Realisationsprinzips als vertraglich begründete Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen bereits bei ihrer jeweiligen monatlichen Entstehung gewinnwirksam zu buchen. Denn bei einem Rahmen-Dienstvertrag als Dauerschuldverhältnis tritt eine Gewinnrealisation zeitraumbezogen – im Streitfall monatsbezogen – ein.
Nachdem diese Forderungen vollständig bestritten wurden, hatte die Steuerpflichtige sie durch eine Teilwertabschreibung auf null ausgebucht. Das FG entschied, dass dies zutreffend erfolgte, da insoweit kein Aktivierungswahlrecht, sondern sowohl für die Handels- als auch für die Steuerbilanz ein Aktivierungsverbot bestand. Denn für die Steuerpflichtige stand fest, dass die offenen Forderungen allein mit anwaltlicher Hilfe und höchstwahrscheinlich nicht mehr im Mahnwege (Mahnbescheid zur Erwirkung eines Vollstreckungsbescheids), sondern nur im Klagewege durchgesetzt werden konnten. Jedenfalls konnte der Forderungsbestand nicht mehr als bereits wirtschaftlich realisiert qualifiziert werden.
Entscheidung
Das FG stellte heraus, dass das Vorsichtsprinzip in Form des Realisationsprinzips als „zwingendes Prinzip“ auch für die Steuerbilanz zu beachten ist. Dies folgt aus dem Grundsatz der Maßgeblichkeit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG i. V. m. § 5 Abs. 6 EStG gibt insoweit kein von den GoB (Vorsichtsprinzip nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) abweichendes steuerrechtliches Wahlrecht. Der Ansatz einer bestrittenen Forderung mit ihren Anschaffungskosten (Nennwert) oder einem darunterliegenden Teilwert kommt daher grundsätzlich nicht in Betracht. Bei einer Forderung, die bereits vor dem Bilanzstichtag nicht mehr anzusetzen ist, stellt sich die Frage einer Teilwertabschreibung zum Bilanzstichtag nicht.
Für den Streitfall bedeutete dies, dass der Ansatz der Forderungen in der Steuerbilanz zum 31.12.2014 nicht mehr in Betracht kam. Denn es bestand zum Bilanzstichtag nicht allein eine bloße Möglichkeit der Gefährdung der tatsächlichen wirtschaftlichen Realisation, sondern der Vermögensvorteil „Forderungsbestand“ war gerade nicht als hinreichend sicher auch wirtschaftlich ausnutzbar im Sinne eines durchsetzbaren gegenwärtigen Vermögenswerts anzusehen.
fundstelle